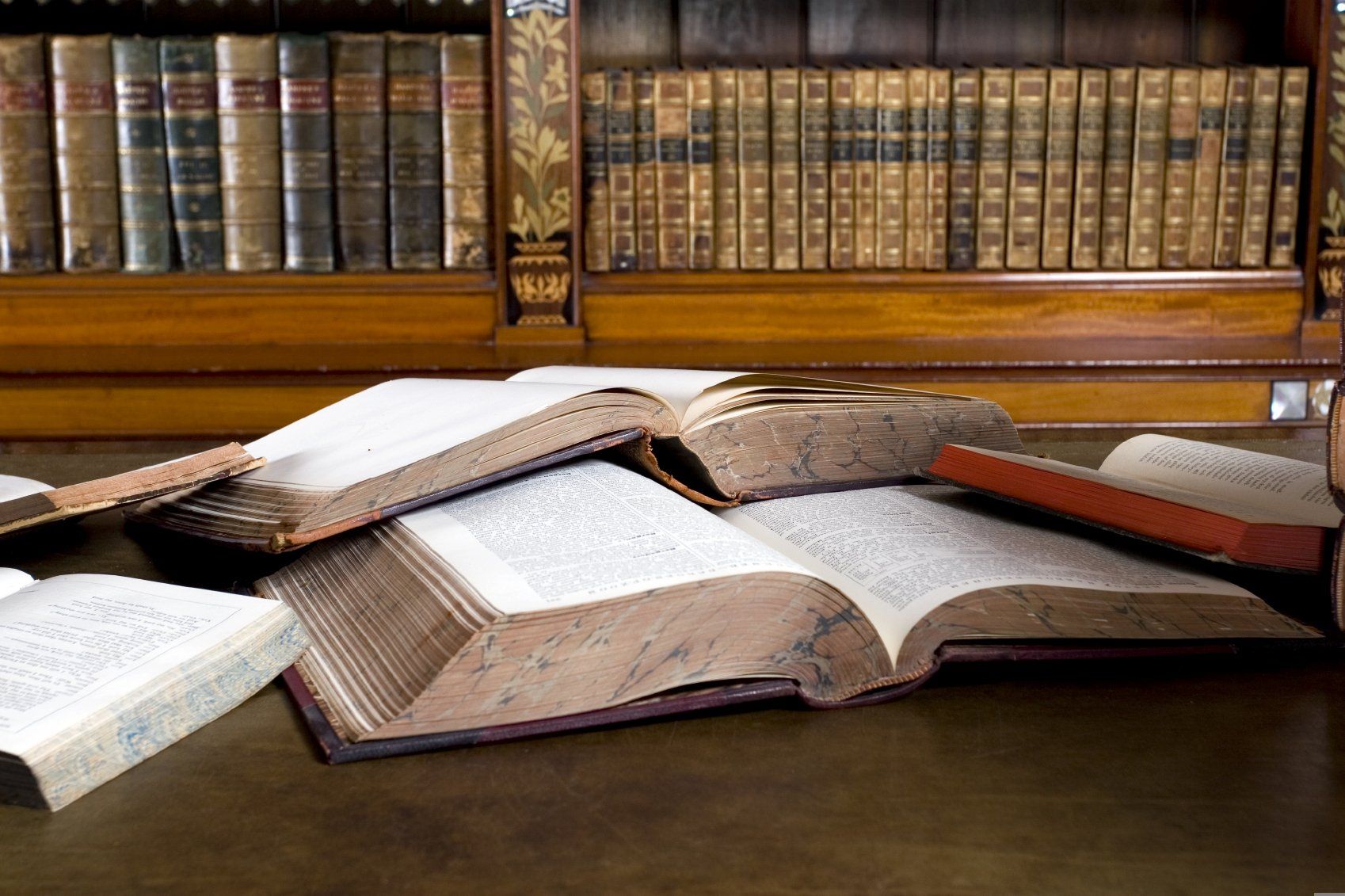Blog

Angst gehört zum Leben. Sie warnt vor Gefahren, hält uns in Bereitschaft und schützt uns. Problematisch wird sie, wenn sie lähmt, den Alltag einschränkt oder uns daran hindert, authentisch zu handeln. Die gute Nachricht: Angst ist kein unabänderliches Schicksal. Mit Selbstreflexion, gezielten Fragen und Übungen können Sie lernen, souverän mit ihr umzugehen. Erste Schritte zur Bewältigung Ihrer Angst Um Angst zu überwinden, hilft es, die Mechanismen zu verstehen und bewusst zu hinterfragen: 1. Wovor habe ich wirklich Angst? Notieren Sie Ihre Ängste klar und konkret. Oft sind sie diffuse Vorstellungen ohne reale Basis. 2. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Viele Ängste übertreiben die Realität. Eine ehrliche Abwägung reduziert die mentale Bedrohung. 3. Will ich das Risiko eingehen oder nicht? Entscheiden Sie bewusst: Handlung statt passives Reagieren. Sie gestalten Ihre eigene Wirklichkeit. Selbst tief verwurzelte Ängste, oft in der Kindheit geprägt, lassen sich verändern. Durch gezielte Reflexion und wiederholtes Üben wird der Umgang mit angstauslösenden Situationen leichter. Wie Angst entsteht Angst ist ein angeborenes, evolutionäres Signal: Biologische Grundlagen: Herzrasen, Zittern, Anspannung, beschleunigte Atmung. Emotionale Reaktion: Unruhe, Beklommenheit, innere Anspannung. Gedankenmuster: Grübeln über mögliche negative Ereignisse. Verhaltensreaktionen: Vermeidung, Rückzug, Beruhigung durch äußere Mittel wie Alkohol oder Ablenkung. Erwachsene Ängste entstehen häufig durch: Traumatische Erlebnisse oder peinliche Situationen. Überängstliche oder kritische Bezugspersonen. Längere Phasen von Stress, Krankheit oder Erschöpfung. Körperliche Faktoren wie Hormonungleichgewicht oder Vitaminmangel Die Angst vor Ablehnung Viele Ängste drehen sich um die Frage: „Was werden andere von mir denken?“ Diese Sorge blockiert Selbstsicherheit und authentisches Handeln. Sie basiert oft auf frühen Erfahrungen: Kinder waren abhängig von Eltern und reagierten existenziell auf Kritik oder Ablehnung. Erwachsene tragen diese Reaktionen noch unbewusst in sich – das innere Kind reagiert wie damals. Negative Selbstgespräche verstärken diese Angst: Worte wie „Feigling“ oder „nicht gut genug“ halten die innere Unsicherheit am Leben. Wichtiger Schritt: Selbstakzeptanz stärken. Wer sich selbst annimmt, lässt sich weniger von der Meinung anderer beeinflussen. Strategien, um Angst zu überwinden 1. Bewusstmachen: Angst entsteht oft aus der eigenen Bewertung der Situation, nicht aus der Situation selbst. 2. Gedanken beobachten: Welche Sätze lösen die Angst aus? („Ich könnte das nicht ertragen.“) 3. Gedanken prüfen: Wie realistisch ist die Gefahr? Gibt es Lösungen, wenn das Schlimmste passiert? 4. Konfrontation mit der Situation: Schrittweise den angstauslösenden Situationen begegnen. Notieren Sie Ihre Gefühle und Erfahrungen. 5. Gefühle zulassen: Körperliche Symptome sind normal. Bleiben Sie in der Situation, bis die Angst nachlässt. 6. Entspannung üben: Methoden wie Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung helfen, das Nervensystem zu beruhigen. Die Rolle des Selbstbildes Wie wir uns selbst sehen, beeinflusst, wie wir Angst empfinden. Wer sich klein, unzulänglich oder minderwertig fühlt, erwartet, dass andere dies spiegeln. Veränderung beginnt daher immer bei der Selbstwahrnehmung: Akzeptieren Sie Ihre Stärken und Schwächen. Stärken Sie Ihr Selbstvertrauen durch positive Selbstgespräche. Lernen Sie, von der Meinung anderer unabhängiger zu werden. Psychologische, neurologische und soziale Hintergründe Psychologisch: Kognitive Dissonanz, Status-quo-Bias, Verlustaversion und Gewohnheitsbildung stabilisieren bestehende Ängste. Neurologisch: Veränderungen erfordern neuronale Anpassung und überwinden von Belohnungsgewohnheiten. Sozial/kulturell: Gruppenzugehörigkeit, normative Erwartungen und gesellschaftliche Strukturen verstärken Ängste und Widerstände. Zusätzliche Information: Persönlichkeitsformen und Angst nach Fritz Riemann Riemann (1961) unterscheidet vier Persönlichkeitsstrukturen, die aus tief verwurzelten Ängsten entstehen: 1. Schizoide Persönlichkeit: Angst vor Nähe, sucht Distanz und Autonomie. 2. Depressive Persönlichkeit: Angst vor Verlust und Verlassenwerden, Bedürfnis nach Bindung. 3. Zwanghafte Persönlichkeit: Angst vor Wandel und Unsicherheit, Kontrolle und Ordnung als Schutz. 4. Hysterische Persönlichkeit: Angst vor Festlegung, sucht Freiheit und Abwechslung. Ein gesundes Leben erfordert Balance zwischen Nähe und Distanz, Stabilität und Wandel. Fazit Angst ist ein Signal, das uns schützen soll – aber oft hemmt es unser Leben unnötig. Durch Selbstreflexion, gezielte Übungen und die Arbeit am eigenen Selbstbild lässt sich Angst abbauen. Schritt für Schritt gewinnen Sie innere Freiheit, Selbstvertrauen und Gelassenheit. Download Arbeitsblatt: Übung und Info zu Angst Wenn Sie Ihre Ängste überwinden und souverän handeln möchten, unterstütze ich Sie gern. Kontaktieren Sie mich für ein vertrauliches Erstgespräch: peter.ganther@solvit-coaching.de Hinweis: Finden Sie zusätzliche Informationen, Checklisten und Arbeitsblätter in meinem kostenlosen Downloadbereich

Viele Menschen kennen das: Das Leben ist voll – Beruf, Familie, Verpflichtungen. Nach außen funktioniert alles, aber innerlich bleibt ein leises Ziehen. Etwas stimmt nicht, ohne dass Sie genau sagen können, was es ist. Diese innere Spannung zeigt sich oft zuerst im Körper – in einem flachen Atem, hochgezogenen Schultern oder einer engen Brust. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie über bewusstes Atmen und sanfte Bewegung wieder mehr Körperbewusstsein und innere Ruhe finden – klar, einfach und ohne Esoterik. 1. Der Körper zeigt, was das Denken verbirgt Ihr Körper ist ein präziser Spiegel Ihrer inneren Haltung. Gestik, Mimik und Körperhaltung verraten mehr über Ihre Einstellungen als Worte. Wer dauerhaft angespannt atmet, signalisiert oft unbewusst: „Ich muss mich schützen“ oder „Ich darf nicht loslassen.“ Mit bewusster Wahrnehmung erkennen Sie diese Muster – und können beginnen, sie zu verändern. Das ist der erste Schritt zu mehr Gelassenheit. 2. Atemübungen gegen Stress: Wahrnehmen statt kontrollieren Ziel: Ihren Atem bewusst spüren, ohne ihn zu verändern. Setzen Sie sich aufrecht hin, die Füße fest auf dem Boden. Schließen Sie die Augen und atmen Sie ruhig ein und aus. Spüren Sie: Wo bewegt sich Ihr Atem – mehr im Brustkorb oder im Bauch? Gibt es Stellen, an denen er stockt? Diese einfache Übung schärft Ihr Bewusstsein für Spannungen und wirkt beruhigend auf das Nervensystem. Tipp: Schon zwei Minuten bewusste Atemwahrnehmung täglich können Stress senken und die Konzentration verbessern. 3. Körperpanzerungen erkennen – und lösen Körperliche Spannung ist kein Zufall. Sie speichert Erfahrungen, Belastungen und Glaubenssätze. Körper-Scan Führen Sie Ihre Aufmerksamkeit von Kopf bis Fuß. Fragen Sie sich: Wo halte ich fest? Wo bin ich offen? Allein das Erkennen ist ein Schritt zur Entspannung. Bewegungsexperiment Ziehen Sie die Schultern zu den Ohren, halten Sie kurz – und lassen Sie dann bewusst los. Wiederholen Sie mit den Fäusten, der Stirn oder dem Nacken. Dieses Wechselspiel zwischen Anspannung und Loslassen schafft sofort spürbare Erleichterung. 4. Haltung und Stimmung – ein direkter Zusammenhang Ihr Körper beeinflusst Ihre Stimmung, und Ihre Stimmung formt Ihre Haltung. Kopf gesenkt, Schultern nach vorne – fühlen Sie, wie eng der Atem wird? Brust öffnen, Blick heben – spüren Sie die Weite? Diese Wechselwirkung ist messbar: Eine offene Haltung fördert tiefere Atmung, Präsenz und Selbstvertrauen. Nutzen Sie das bewusst – besonders in Momenten, in denen Sie sich klein oder unsicher fühlen. 5. Mimik bewusst einsetzen: Der kürzeste Weg zu innerer Leichtigkeit Unsere Gesichtsmuskeln beeinflussen das emotionale Erleben. Probieren Sie verschiedene Gesichtsausdrücke aus – neutral, skeptisch, erfreut. Beobachten Sie, wie sich Atem und Stimmung verändern. Ein sanftes Lächeln ist keine Floskel – es kann den Parasympathikus aktivieren, also den Teil Ihres Nervensystems, der für Ruhe sorgt. 6. Mikro-Bewegungen für mehr Energie und Klarheit Schulterkreisen Lassen Sie die Schultern langsam nach hinten und vorne kreisen. Diese einfache Bewegung löst Verspannungen im Nacken- und Brustbereich – besonders hilfreich bei Bildschirmarbeit. Kopf- und Blickbewegungen Drehen Sie den Kopf sanft nach rechts und links. Beobachten Sie, ob Ihr Atem dabei leichter fließt. Kleine Bewegungen genügen. Gewicht verlagern Stellen Sie sich hin und verlagern Sie Ihr Gewicht auf einen Fuß. Spüren Sie: Wo fühlen Sie sich stabil, wo frei? Diese Übung fördert Körperbalance und innere Erdung – ein gutes Mittel gegen Stress und Grübeln. 7. Reflexion: Bewusstheit beginnt mit Spüren Nehmen Sie sich am Ende einen Moment der Ruhe. Wie fließt Ihr Atem jetzt? Wo fühlen Sie mehr Raum, mehr Weite? Wahrnehmung ist kein Ziel, sondern ein Weg. Wer spürt, was im Körper geschieht, versteht seine inneren Bewegungen – und gewinnt innere Stabilität. Fazit: Innere Ruhe durch Körperbewusstsein Atem, Haltung und innere Einstellung bilden ein System. Wer den Atem befreit, befreit auch Denken und Fühlen. Kleine Übungen – regelmäßig durchgeführt – können nachhaltige Veränderungen bewirken: weniger Stress, mehr Klarheit, mehr Selbstvertrauen. Wenn Sie spüren, dass Ihr Körper mehr weiß, als Sie denken – beginnen Sie beim Atmen. Der erste bewusste Atemzug kann der Beginn echter Veränderung sein. Kostenloser Download Arbeitsblätter: Atem und Bewegung und Atmung und Bewegung Feldenkrais Wenn Sie mehr wissen möchten: peter.ganther@solvit-coaching.de

In diesem Video geht es um eine Methodik, um selbstoptimierende Prozesse anzustoßen und deren Nachhaltigkeit auch zu gewährleisten. In fünf einfachen Schritten weg von unangenehmen Eigenschaften der eigenen Persönlichkeit. Hinweis: Finden Sie zusätzliche Informationen, Checklisten und Arbeitsblätter in meinem kostenlosen Downloadbereich

Coaching ist kein Medikament. Sie gehen nicht zum Coach wie zu einem Arzt und der macht sie wieder "heile". Coaching ist eine Intervention, die auf Augenhöhe praktiziert wird. Der Coach hört aktiv zu und fragt nach; er regt die Klienten zur Selbstreflexion an und stimuliert ihre Ressourcen. Coaches lösen aber nicht die Probleme ihrer Klienten. Das müssen Sie als Klient schon selbst tun. (Carsten C. Schermuly, Erfolgreiches Business-Coaching, 1.Auflage 2019, S.17, Beltz Verlag, ISBN 978-3-407-36632-0) Professionelles Coaching setzt ganz auf die Entwicklung individueller Lösungskompetenz beim Klienten. Der Klient bestimmt das Ziel des Coachings. Der Coach verantwortet den Prozess, bei dem der Klient neue Erkenntnisse gewinnt und Handlungsalternativen entwickelt. Dabei wird dem Klienten die Wechselwirkung seines Handelns in und mit seinem Umfeld deutlich. Coaching ist als strukturierter Dialog zeitlich begrenzt und auf die Ziele und Bedürfnisse des Klienten zugeschnitten. Der Erfolg von Coaching ist messbar und überprüfbar, da zu Beginn des Prozesses gemeinsam die Kriterien der Ziel-erreichung festgelegt werden. (Coaching Definition nach dvct (Deutscher Verband für Coaching und Training e.V., dvct 2016) Wie deutlich zu erkennen ist, wird vom Klienten auch erwartet, dass er sich mit einbringt, zulässt, reflektiert, offen ist für Neues, manchmal auch "ungemütliches Terrain" betritt und seine Komfort-Zone verlässt. Dabei begleitet und unterstützt ihn der Coach nach besten Kräften, wohlwollend, niemals wertend, immer auf Augenhöhe, das klassische "Lehrer/Schüler"-Verhältnis entsteht hier idealerweise nicht. Der Klient muss sich auch nicht "ausziehen", da Coaching, anders als eine Therapie, lösungsorientiert ist, und nicht problemorientiert. (Peter Ganther) Und was kann Coaching? Vorausgesetzt beide Beteiligten, Coach und Klient, arbeiten professionell nach bestem Wissen und Gewissen. Der Coach muss mit transparent nachvollziehbaren Methoden arbeiten, dann können erhebliche Veränderungen und Ziele erreicht werden. Es sollten hierbei aber immer die Ziele des Klienten sein und nicht die des Coaches. Konkretere Aussagen zu treffen, wäre unseriös. Tatsächlich ist das auch nicht möglich, da Coachingprozesse immer begleitet werden von Einflüssen, deren Tragweite erst im Prozess erkennbar werden. (Peter Ganther) Hinweis: Finden Sie zusätzliche Informationen, Checklisten und Arbeitsblätter in meinem kostenlosen Downloadbereich

Das Organisationsprinzip des dauerhaften Wandels Die Voraussetzung für dauerhafte Veränderungen umfasst zuerst 3 Schritte: 1. Stelle höhere Ansprüche an Dich selbst. Immer, wenn Du eine ernsthafte Veränderung anstrebst, musst Du zuerst die Ansprüche hochschrauben, die Du an Dich hast. 2. Wirf alte Glaubenssätze über Bord und ersetze sie durch neue. Da man Glaubenssätze nicht löschen kann, müssen sie durch neue ersetzt werden. Reframing* ist hierbei sehr hilfreich. 3. Ändere Deine Strategie. Die beste Strategie besteht darin, nach einem Vorbild Ausschau zu halten, nach Menschen, die bereits erreicht haben, was Du anstrebst Viele Menschen wissen, wie sie handeln sollten, aber nur wenige handeln entsprechend ihres Wissens. Die fünf Lebensbereiche, die uns am stärksten beeinflussen und deren Beherrschung Eigene Gefühle Alles, was wir tun, dient der Veränderung unserer Gefühle. Es ist erstaunlich, wie oft wir von unserer Intelligenz gebrauch machen, um uns in völlig unproduktive Gefühlszustände zu versetzen und darüber die Fülle angeborener Talente vergessen. Physische Befindlichkeit Wie gesund und vital fühlst Du Dich und welchen Einfluss hat das auf Dein Denken, Fühlen und Handeln? Zwischenmenschliche Beziehungen Lerne, Deine zwischenmenschlichen Beziehungen zu steuern. Finanzielle Situation Je mehr Geld Du besitzt, desto stärker ist die Belastung, die Du empfindest. Der Schlüssel ist nicht das bloße Streben nach Wohlstand, sondern eine Veränderung Deiner Glaubensmuster und Einstellungen, so dass Du Geld auch als Mittel zum Zweck siehst und nicht als Gipfel des Glücks. Zeitmanagement Es geht darum, sich Zeit zu nehmen, sie geschickt auszudehnen und so zu handeln, dass sie sich als Dein Verbündeter erweist. Wenn Du keine grundlegenden Richtlinien für das aufstellst, was Du in Deinem Leben zu akzeptieren bereit bist, dann verfällst Du leicht in ein Denk- und Verhaltensmuster, das weit unter Deinem Niveau liegt. Es kommt nicht auf Deine Ausgangssituation an, sondern vielmehr um die Entscheidung, welches Ziel man hat. (Aus "Das Power-Prinzip" von Anthony Robbins, Heyne-Verlag, München,1992) Hinweis: Finden Sie zusätzliche Informationen, Checklisten und Arbeitsblätter in meinem kostenlosen Downloadbereich